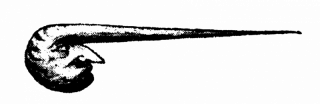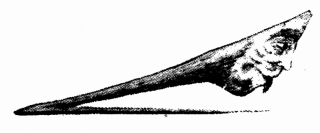Eine kleine Burg
Paul Scheerbart
Meine Tinte ist meine Tinte!
Eine kleine Burg
Kopf— Vignette
aus: Meine Tinte ist meine Tinte!
aus: Na prost!
Eine kleine Burg lacht hoch oben auf dem Berge. Sinnend steh ich unten und — will was.
«Glaubst du an mich?»
Also hör‘ ich’s fragen vor mir in einer Höhle.
«Nein!» sag‘ ich.
«Denn», so fahr‘ ich in Gedanken fort, «Ich will nicht an das glauben, was in Höhlen wohnt.»
Und leise säuselt der Wind durch’s Gebüsch, fächelt behutsam wie eine Sklavin Nebukadnezars meine heiße Backe, schwirrt an der Höhle vorüber, und ich höre wieder aus der Höhle hervortönen:
«Du bist doch aber noch nicht auf dem Berge, warum verachtest du mich denn?»
«Du Schaf!» versetz‘ ich, «weil du niemals auf einen Berg hinauf willst.»
Zischen antwortet. Ich blick‘ hinauf zur kleinen Burg und — und — will was… doch allmählich wird’s mir klar — ich will in der Burg oben wohnen — — — wohnen.
«Mußt erst raufkommen!» tönt’s höhnisch aus der Höhle hervor.
— — und da fällt mir ein, daß ich überhaupt noch nicht wohne — nirgendwo.
Na Prost:
Über diese Dichtung denken die Geister der achtkantigen Flasche ungemein eifrig nach; sie nehmen ihre gesamte Gehirnkraft zusammen.
Es ist keine Kleinigkeit, eine zehntausend Jahre alte Dichtung einigermaßen vernünftig zu erklären.
Aber die Drei sind in jeder Beziehung «erstklassige» Gelehrte — bekannt auf dem ganzen Erdenland, das jetzt allerdings längst entzwei ist. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Und Brüllmeyer ergreift das Wort:
«In dieser kleinen Burg», sagt er, «Scheint mir die Wurzel allen Dichterelends zu stecken. Die Dichter waren eben zu allen Zeiten zur Heimatlosigkeit verdammt. An das einfache Volk, das unten in Höhlen wohnt, glauben sie nicht; die Stimme aus der Höhle ist allen Dichtern Nichts als Schafsgeblök. Doch an die kleine Burg hoch oben auf dem Berge können die armen Dichter wieder nicht ran; da will man sie nicht. Und so bleiben sie ewig obdachlos unter freiem Himmel, wo’s natürlich nicht bequem ist. Die Dichter sollen wohl immer dem freien Himmel möglichst nahe bleiben. Als Leitspruch hätte davor stehen können: Wen der Herr lieb hat, den züchtigt er.»
Passko sagt dazu nach einer Weile.
«Mir scheint hier bloß die peinliche Stimmung jener stets starrsinnigen Menschen dargestellt, die plötzlich genötigt werden, Partei zu ergreifen, und dann zunächst mal zwischen Aristokratie und Demokratie — zwischen Ritter und Spießbürger — wählen müssen. Sie wollen natürlich ‹eigentlich› von der ganzen Sippschaft Nichts wissen, ob sie nun in Höhlen oder in Burgen wohnt. Und da bemerken sie denn, daß sie überhaupt noch keine Heimstätte haben. Eine peinliche Entdeckung! Der Fluch der Sucht nach Freiheit scheint mir hier in ein treffliches Sinnbild gebracht zu sein.»
Der alte Kusander spricht kurz folgendermaßen:
«Es kommt mir hier die wichtigste Wehmutsstimmung eines sogenannten Zigeuners zum Ausdruck. Es wird uns, wie Passko schon ganz richtig bemerkte, die Schattenseite der Freiheit gezeigt. Die Geschichte dürfte auch ‹die Vogelfreiheit› genannt werden. Übrigens bin ich nicht der Meinung, daß die Burg das Rittertum darstellen soll; das gabs zu Kants und Schopenhauers Zeiten bloß noch dem Namen nach. Wahrscheinlich hat der Verfasser mit der kleinen Burg nur ein kleines Haus gemeint, in dem er ‹ungestört› allein leben kann.»
Brüllmeyer meint dann freudig:
«Unsre Meinungen klingen gut zusammen. Im wesentlichen widersprechen wir uns nicht. In der Sklavin Nebukadnezars sehe ich übrigens ‹die Üppigkeit der weiten Ferne› angedeutet.»
Der kluge Passko flüstert nun träumerisch:
«Die Üppigkeit der weiten Ferne! Hm! Man kann in dieser Dichtung auch die Tragödie des ewig heimatlosen Menschentums erblicken. Wer fühlte sich denn auf der Erde jemals daheim?»
Kusander antwortet fest:
«Keiner! Nur in der ganzen Welt am Herzen Gottes sind wir zu Hause. Wir wären also in der achtkantigen Flasche auf dem besten Wege, mal nach Hause zu kommen.»
Die Drei sitzen grübelnd da, und Brüllmeyer macht nach langer Pause die Schlußbemerkung:
«Jedenfalls ist die Geschichte gut, wenn ich auch glaube, daß das Herz Gottes überall ist. Laßt uns nun nicht weiter nachdenken — laßt uns auf das Wohl des unbekannten Dichters zehn große Gläser Narrenwein trinken!»
Die Gelehrten tun’s!
* * *
Der Himmel ist prächtig und mit keinem Dinge, das einst auf Erden zu sehen war, zu vergleichen.
Die goldenen Streifen glitzern.
Die purpurnen Streifen glühen.
Die blauen Streifen leuchten.
Die grünen Streifen blenden.
Und die anders gefärbten Streifen sehen zuweilen gleißend bunt aus wie klebrige Schlangen — und oft brennen sie wie Diamanten.
Alle Streifen laufen parallel zueinander — alle werden von Zeit zu Zeit dicker und danach wieder dünner.
Das bißchen Himmel zwischen den Streifen ist schwarz und kommt auch nur als Streifen zur Geltung.
Der gestreifte Himmel macht den drei Zechern in der achtkantigen Flasche riesigen Spaß.
* * *
Und einige Zeit darauf, als mal wieder die Emailuhren aufgezogen werden (die drei Geister sind grade durch allzu reichlichen Krebsscherengenuß in eine unbehagliche Stimmung geraten) holt Brüllmeyer ein zweites, zehntausend Jahre altes Blättchen hervor — und zwar:
Index: Erzählungen – NaProst . Meine Tinte ist meine Tinte!
alle Texte von Paul Scheerbart – ein fognin Projekt – bitte unterstützen:
![]() Bitte helfe mit diese Seite zu erhalten:
Bitte helfe mit diese Seite zu erhalten: 
![]() Diese Seite von fognin ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung – Nicht-kommerziell – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz. Weitere Infos über diese Lizenz können Sie unter hier erhalten
Diese Seite von fognin ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung – Nicht-kommerziell – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz. Weitere Infos über diese Lizenz können Sie unter hier erhalten
Revision 03-01-2023