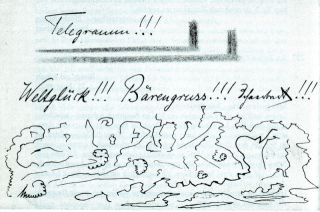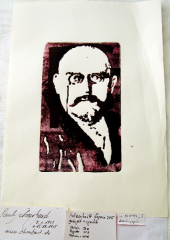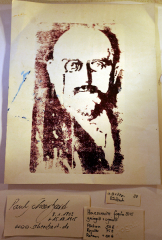Tarub Bagdads berühmte Köchin
Das sechste Kapitel.
Die Mongolen reiten langsam um die Sternwarte rum und spitzen die Ohren — sie hören was.
Sie zügeln ihre schwarzen Rosse und horchen weit über den Kopf der Pferde gebeugt in das Dunkel hinein.
Dann erkennen sie die Stimmen, reiten rasch an den Turm, der oben den Empfangssaal trägt, und wecken die Schwarzen.
Nach ein paar Augenblicken sind die zwölf schwarzen Sklaven mit zwölf Fackeln draußen.
Die Sklaven eilen mit den Fackeln dem Herrn Battany, der mit seinen Freunden, den Mädchen, den Flötenspielern und Weinschläuchen langsam näher kommt, diensteifrig entgegen.
Die Fackeln erleuchten den Pfad.
Die Mongolen sitzen auf ihren Pferden ganz stramm.
Und bald sind Alle oben im Empfangssaal.
Nur die Mongolen sind unten geblieben.
Der Herr Battany ist guter Dinge und schickt gleich die Flötenspieler in den dritten Turm, in dem er gewöhnlich zu arbeiten pflegt.
Die Sklaven mit den Fackeln werden auf den Galerien, den beiden anderen Türmen und auf dem Altane verteilt.
Auf dem fünfeckigen Altan leuchten jetzt fünf Fackeln in fünf schwarzen Fäusten.
Die drei Mädchen schenken den Wein in die großen Becher.
Und Alle trinken die großen Becher in einem Zuge aus.
Und dann küssen die drei Mädchen den Battany und seine sieben Freunde so stürmisch, daß Allen ganz schwindlig wird.
Jetzt wird’s sehr laut.
Alles lacht und schreit.
Der Wein berauscht.
Und Abla will singen — doch sie will nur singen auf Abu Maschars hohem Turm — Abu Maschar soll mitkommen.
Der Prophet geht schließlich lächelnd mit der weißen Abla auf seinen Turm.
Und Abla singt oben den neuesten Gassenhauer — die berühmten Sareppastrophen, die im Jahre 892 nach Christi Geburt in allen Schänken Bagdads gesungen wurden.
Die Strophen waren von einem unbekannten Sänger der berüchtigten Sareppa gewidmet.
Die Sareppa ist eine schlitzäugige Mongolin, die besser reiten kann als die Beduinen.
Die Abla singt:
»Warum bist Du bös auf mich, Wilder brauner Wüstensohn? Warum bist Du ärgerlich? Ist das meiner Liebe Lohn? Schenk mir Dein Roß Und schenke mir Rosen! Liebst mich heute ganz allein — Morgen muß es anders sein. Komm wieder rein! Ich schenk Dir Wein! Willst Du eifersüchtig sein? Ach, Du bist es nicht allein — Hör doch meine Freunde schrein — Jeder will mich heut schon frein — Schenk mir Dein Roß! Komm wieder rein! Willst Du meine Freunde schlagen, Steigst Du noch in meiner Gunst. Mußt Dein Leben für mich wagen, Sonst ist Lieben keine Kunst. Schenk mir Dein Roß — Und schenke mir Rosen! Liebst mich heute ganz allein — Morgen muß es anders sein.«
Alle lauschten — die Strophen klangen weich und voll durch die Nacht.
Die Fackeln flammten unheimlich in den Sternenhimmel hinauf.
Unten flüsterten die Mongolen — oh — die kannten die Sareppa.
Die Abla hatte nicht so gesungen, wie man die Sareppastrophen in den Schänken zu singen pflegt — Manches hatte so schwermütig geklungen.
Im Empfangssaal hätten die Männer beinah das Trinken vergessen…..
Doch die Menschen werden so anders, wenn sie beim Trinken sind.
Jakuby wackelt immer mit dem Kopf und mit seinem lila Turban — redet fortwährend zu Osman von Byzanz und von Damaskus, setzt dem dicken Schreiber auseinander, daß er in diesen beiden Städten jede einzelne Sängerin gehört habe. Osman will das garnicht glauben.
Battany ist zur Sailóndula sehr höflich, ist entzückt von ihren kleinen Füßen, ihren Veilchen und ihren Augen — nur ihr weingrünes Gewand will ihm nicht gefallen.
Kodama streichelt der Tarub die braunen Wangen und raubt ihr eine dunkelrote Rose.
Suleiman sitzt auf dem großen Teppich, trinkt und lacht, wundert sich, daß die Andern nicht auch sitzen und lachen. Die Andern lächeln nur.
Abu Hischam und Safur stehen auf dem fünfeckigen Altan und reden mit einem fürchterlichen Eifer über die Welt und über den Genuß. Die Schwarzen mit den Fackeln staunen.
Kodama singt:
»Schenk mir Dein Roß — Und schenke mir Rosen!«
Und der Dicke trinkt mit der Tarub — er ist schon recht heiter.
Sailóndula schaut zuweilen scheu zu dem indischen Götzenbild hinüber.
In Battanys Arbeitszimmer flöten die Flötenspieler — sie haben auch Wein zu trinken bekommen.
Abu Hischam sagt:
»Lieber Safur, wir täuschen uns ja so oft. Wenn wir träumen, denken wir doch immer — wir wachen. Müssen wir deswegen nicht auch in unseren wachen Augenblicken — an unserm Wachsein zweifeln? Wenn wir aber erst zweifeln, daß dieser Altan ein Altan ist, so wird uns doch der Boden unter den Füßen fortgezogen — dann schwankt Alles — ja, Safur, dann schwankt Alles!«
Und der Philosoph schwankte wirklich, worüber Safur sehr lachen mußte.
Sie tranken wieder — Saids Diener schenkten diensteifrig immer von Neuem die großen Becher voll — der erste Weinschlauch lag schon schlaff hinter dem kupfernen Himmelsglobus.
Abu Hischam spricht weiter:
»Ja, Safur, Du hältst Dich für einen großen Schlaukopf. Du willst immer mit Deinen Sinnen genießen — ei wenn Deine Sinne garnicht da sind — was dann? Das Zweifeln mußt Du lernen, das Zweifeln hast Du noch nicht raus. Leben heißt zweifeln. Genießen heißt auch nur zweifeln. Immer schwanken muß man. Die großen Weisen schwanken und zweifeln immer. Trotzdem kann man ganz vernünftig sein — man braucht deswegen nicht zum Gewohnheitssäufer zu werden. Man kann trotzdem das Große wollen — die Welt kann noch alle Tage besser werden — für die Entwicklung der Welt müssen wir sogar kämpfen. Das ist ja der Hauptgenuß — wer an der Verbesserung der Welt arbeitet — — der pfeift auf das Fressen und Saufen — der pfeift!«
Der große Philosoph schwankt und pfeift.
Die Flötenspieler flöten.
Safur legt ernst seine Hand auf Abu Hischams Schulter und redet nun also:
»Du irrst Dich, wenn Du glaubst, daß ich nur mit meinen fünf Sinnen genießen will. Ich will genießen in allen Formen — in jeder Weise — wie — wo — was — das ist mir ganz gleich. Aber Alles will ich genießen — und daher will ich auch mit meinen fünf Sinnen genießen. Immer will ich genießen — daher will ich auch genießen, wenn ich esse. Allerdings — Du sagtest, es gäbe noch eine übersinnliche Welt. Ich glaube ja an diese übersinnliche Welt. Die soll drum auch für mich da sein. Indessen — nur übersinnlichen Genüssen nachgehen — das scheint mir sehr unsinnig. Das kriegen wir ja garnicht fertig. Ich kann doch nicht immerfort an Wüstengeister denken. Allerdings — Du hast Recht. Zu große Bedeutung darf ich den Genüssen der Zunge nicht beimessen.«
Safur denkt nach. Abu Hischam trinkt.
Abu Hischam sieht so furchtbar altbacken aus — nüchtern ist er auch nicht mehr.
Und Abla’s Stimme ist nun auf der Galerie nebenbei zu hören, sie singt leise zu Abu Maschar:
»Komm wieder rein! Ich schenk Dir Wein!«
Das singt sie öfters.
Der Prophet ist gutmütig freundlich zu ihr wie ein milder Vater.
Die Beiden betreten jetzt den Altan.
Safur begrüßt sie sehr freundlich, Abu Hischam sehr spöttisch.
Abu Maschar ist milde wie gewöhnlich.
Die Drei trinken zusammen und reden.
Sie reden aber Dinge, die so schwer verständlich sind, daß sich die weiße Abla traurig abwendet.
Den Schwarzen macht das Fackelhalten wenig Spaß — die Sache ist auch nicht grade leicht.
Abla sieht in den Empfangssaal.
Da brennen oben die maurischen Lampen.
Rechts neben dem kupfernen Waschbecken liegen die vollen — links die leeren Weinschläuche. Im Hintergrunde stehen Saids Diener. In der Mitte des Hintergrundes unter der indischen Götzenfigur liegt der alte Dichter Suleiman und schläft — er ist abgefallen.
Battany wandelt in seiner blauen Sammettoga mit der Sailóndula auf dem großen Teppich umher — so vertraut und gemütlich.
Ungefähr in der Mitte des Teppichs sitzt Kodama neben einem Weinschlauch — im Arme des dicken Geographen befindet sich die Tarub, die sich von dem Dicken lachend küssen läßt und ihm fleißig Wein einschenkt.
Die Flötenspieler spielen nicht — man hört nur reden, lachen und flüstern.
Die beiden Säulen, die zwischen Altan und Empfangssaal die drei Spitzbogen tragen, sind nur dünn und können das Durchsehen nicht hindern….
Die Abla sieht Alles.
Und sie ärgert sich über Kodama und auch über die Tarub, singt spöttisch sehr laut und hell:
»Liebst mich morgen ganz allein — Heute muß es anders sein.«
Und das singt sie immer wieder, bis das der leichtsinnige Kodama versteht.
Gleichzeitig sieht aber auch der Safur seine Tarub in Kodamas Arm.
Donnerwetter — da wird er wütend.
Der Dicke läßt sich aber nicht leicht aus der Fassung bringen, ruft dem Dichter mit wohltönender Stimme zu:
»Du schlauer Safur — wir sind ja gute Freunde. Unter Freunden nimmt man sich so was doch nicht übel. Ich wollte nur die kleine Abla ein bißchen eifersüchtig machen! Sei wieder gut!«
Safur aber knirscht mit den Zähnen, daß es Alle hören.
Alle sind jedoch ziemlich berauscht, sodaß man diesen knirschenden Wutlauten nicht zu große Bedeutung beimißt.
Nur Battany merkt, daß die Lustigkeit der Zecherei gestört werden könnte und schreit daher mit donnernder befehlender Stimme:
»Sailóndula wird hier auf unsrem Teppich tanzen. Kodama, steh auf! Safur, sei vernünftig! Trink, Bruder! Sailóndula, tanz! Alle Sklaven sollen mit den Fackeln in den Saal kommen!«
Die Rede wirkt.
Man holt die Flötenspieler. Die zwölf Schwarzen kommen mit den Fackeln in den Saal.
Kodama und Tarub stehen auf.
Suleiman wird an die Seite gelegt.
Auch Jakuby erscheint jetzt wieder, er fällt immer hin und fuchtelt mit dem Zeigefinger durch die Luft, was sich sehr albern ausnimmt.
Der dicke Osman kommt auch mit den Flötenspielern zusammen herein, er ist schrecklich lustig und kneift den Schwarzen in die Backen.
Die Schwarzen grinsen.
Sie sehen drollig aus.
Dann aber bittet der große Al Battany seine Freunde auf den jetzt dunkeln Altan hinaus — die Tarub und die Abla werden von ihm ganz besonders höflich gebeten.
Tarub schimpft auf den Safur.
Abla singt dazu:
»Eifersüchtig willst Du sein? Ach Du bist es nicht allein!«
Safur lacht und küßt die Abla.
Man trinkt wieder — noch hastiger als bisher.
Wenn Sailóndula tanzt — dann hat das was zu bedeuten.
Schade nur, daß der Suleiman schläft; der sieht so gern tanzen.
Abu Hischam, der kaum stehen kann, will jetzt wieder lallend vom Bunde der lauteren Brüder reden, man hält ihm aber den Mund zu und bittet ihn, sich hinzusetzen.
Ach — die Menschen werden so anders, wenn sie getrunken haben.
Im Empfangssaal thront die indische Götzenfigur — rechts und links neben ihr stehen die Flötenspieler mit den Flöten.
Die Sailóndula im weingrünen Kleide geht in die Mitte des Teppichs und blickt noch einmal scheu zum indischen Götzen hinauf.
Vier Schwarze stellen sich an die hintere Seite des Teppichs — vier rechts und vier links.
Die Fackeln flammen hoch auf.
An der Decke wirbeln die Rauchwolken.
Der indische Götze leuchtet und glänzt.
Auch der kupferne Himmelsglobus wirft das Fackellicht zurück, das kupferne Waschbecken gleichfalls.
Battany sitzt mit Tarub und Abla hinter dem Mittelbogen, die Andern sitzen und stehen hinter und neben dem Astronomen.
Und Sailóndula tanzt.
Die Flötenbläser spielen ein altes indisches Lied — das klingt so weich und getragen.
Langsam bewegt die Sailóndula die Arme durch die Luft und biegt dabei den Körper nach allen Seiten.
Ihre gelben Finger recken sich, und die Arme drehen sich, und die Füße heben sich dabei — nur wenig — nur so zaghaft.
Die Muskeln der Beine spannen sich, und dann dreht sich der ganze Körper der Tänzerin.
Die gelben Glieder drehen sich und beugen sich und krümmen sich — sie bewegen sich — wie sich die Weisen der Flöten bewegen — wie sich Bäume bewegen im Abendwinde — wie sich Schlingpflanzen ranken — wie sich kleine Quellen durch die Wiesen winden.
Und die Fackeln qualmen, daß man das indische Götzenbild kaum mehr sieht.
Man sieht nicht mehr die Decke mit ihren blauen und grünen Mustern auf dem prächtigen Goldgrunde.
Aber man sieht noch die silbernen und roten Querstreifen auf den Wänden, die blitzen oft auf im Fackelschein.
Die Schwarzen stehen tiefernst; mit beiden Fäusten halten sie die Fackeln; ihre orangefarbigen Lendentücher leuchten.
Die zwölf roten Flammen knistern.
Die Flöten ziehen in weichen Tönen durchs Gemach.
Die indische Sailóndula tanzt.
Doch jetzt wollen Alle, daß Sailóndula nackt tanze.
Sie besinnt sich.
Und Battany legt sich aufs Bitten.
Abla bittet den Kodama um die roten Rosen, die er der Tarub geraubt, singt leise:
»Schenk‘ mir Dein Roß Und schenke mir Rosen!«
Doch dann tanzt Sailóndula nackt, ihr weingrünes Gewand fliegt hastig an die Seite.
Die Flötenspieler spielen ein wildes Jagdlied.
Hei — wie sich die gelben wunderschönen Glieder jetzt bewegen.
Nicht mehr ruhig ist der Tanz.
Ein wildes tolles verzerrtes Springen und Stampfen geht los.
Der Körper des Mädchens zittert.
Sailóndulas Muskeln schwellen an, daß sie fast so stark erscheinen, wie die Muskeln der schwarzen Fackelträger.
Aber jetzt — plötzlich — da weiten sich die Augen der nackten Tänzerin.
Sie sieht was — ein alter indischer Tempel steigt vor ihr auf — mit herrlichen Pforten und reizend durchbrochenen Türmen, die wie Filigrangebilde sich aufrecken — wie Elfenbeinschnitzereien…
Und neben dem Tempel fließt der heilige Ganges im Fackelschein.
Und ein Jüngling kommt aus dem Tempel raus und starrt die Sailóndula an.
Mit einem gellenden Schrei bricht das Mädchen zusammen.
»Mein Kleid! Mein Kleid!« ruft es angstvoll.
Battany und seine Freunde eilen auf die gelbe Tänzerin zu; sie wissen nicht, was ihr fehlt.
Sie aber reißt sich mit den Nägeln den Busen blutig, daß das Blut ihren gelben Leib hinunterrieselt.
Und dann brechen ihr die Tränen hervor.
»Meine Heimat!« schluchzt sie.
Und dann weint die Sailóndula wie ein Kind — wie ein ganz kleines Kind.
Battany gibt ihr Wein.
Doch sie schlägt ihm den Becher aus der Hand.
Sie weint furchtbar und windet sich dann in Krämpfen.
Das siebente Kapitel.
»Endlich!« schreit Kodama in den frischen Morgenwind hinein, »endlich sind wir die dummen Frauenzimmer wieder los. Die Tarub schnauzt, die Sailóndula heult und die Abla will immerfort Rosen haben. Freunde, wir sind frei — darum wollen wir jetzt auf dem Karawanenplatz Tee trinken. Kommt!«
Und der dicke Geograph geht breitbeinig voran — die beiden Dichter Suleiman und Safur folgen — der Philosoph Abu Hischam desgleichen.
Diese vier Leute hatten die drei Frauen nach Hause gebracht — mit Mühe — wie sich ja denken läßt — denn nüchtern war Niemand.
Äußerlich machten jetzt die Vier einen sehr friedlichen Eindruck.
Das war aber Alles nur Schein.
Der Wein hatte die Gemüter ganz gehörig aufgeregt.
Gereizt wandte sich Safur an den dicken Kodama und verlangte Aufklärung in Betreff der Tarub — den Dichter plagte heiße Eifersucht. Ein Wort gab das andre — der sonst so gemütliche Geograph mit den herrlichen seidenen Hosen hatte seine ganze wohltönende Beredsamkeit aufzubieten, um den Dichter davon zu überzeugen, daß eine Umarmung doch nur eine Umarmung und ein Kuß doch nur ein Kuß sein könnte.
Der gemütliche Dicke trat währenddem in die Bude eines alten Wunderdoktors und ließ sich in vier zierlichen Näpfchen ein schwarzbraunes dickflüssiges Getränk verabreichen, das Wunder tun sollte gegen den Kater.
Alle tranken das schwarzbraune Zeug und fühlten sich gleich beruhigt — auch Safur.
Leichtgläubig wie alle Dichter ließ auch dieser leicht sich was einreden.
Das schwergläubige Mißtrauen schien dem Safur ohnehin eine recht lästige Sache.
Die Hitze ist auch schon recht lästig.
Grelles Sonnenlicht flutet durch ganz Bagdad, obgleich es noch immer Morgen ist.
Auf dem Karawanenplatz sieht es sehr bunt aus — der Platz ist so bunt wie ein Opal.
Die hellen Zelte, auf denen die Sonne brennt, geben dem großen Karawanenplatz das Ansehen eines großen Lagers.
Die mächtigen Blätter der Bananen und die riesigen Palmen ragen in den hellblauen Himmel so beruhigend hinauf — so beruhigend wie das Grün der Oasen.
Links zeigt ein indischer Schlangenbändiger seine Künste.
Suleiman soll bezahlen und tut’s.
Suleiman denkt nur an den Schneider Dschemil, denn Said hat dem Dichter eine dicke Goldrolle geschenkt — zum Lohne für das Lobgedicht.
Das Gold hat den Alten schrecklich glücklich gemacht — er benimmt sich zuweilen ganz närrisch.
Neben ruhenden Kamelen liegen prächtige bunte Teppiche aus Smyrna und Damaskus.
Gelbe Chinesen stehen feierlich neben grellfarbigen Seidenstoffen.
Braune Araber handeln mit Wollenzeug, Baumwolle und Leinen — die Stoffe zeigen auch alle Farben — rote, blaue, gelbe, braune und andere.
Alte Ägypter verkaufen Rosenöl und Räucherwerk.
Perser mit langen schwarzen Bärten bieten lustigen braunen Mädchen himmelblauen Türkisenschmuck an. —
Und betrunkne Tofailys kommen jetzt torkelnd und johlend immer näher — sie sehen Kodama, brüllen ihm was zu — und dabei fällt der eine Tofaily wie ein abgehackter Baum auf die eine Seite mitten in ein großes Lager irdener Töpfe und Kruken, die ein alter Mann aus Kufa neben sich auf der Erde fein säuberlich aufgestellt.
Mörderliches Geschrei! Das Geschirr klirrt und klappert.
Ein frecher nackter Junge reitet auf einem kleinen grauen Elefanten heran — und das Tier zerschlägt auch noch ein paar Töpfe.
Höllenlärm!
Die Tofailys lachen, sind aber in großer Not — die Kaufleute auf dem Karawanenplatz verstehen im Entzweischlagen keinen Spaß.
Kodama bezahlt schließlich die zerbrochenen Gefäße — widerwillig zwar — doch mit Anstand.
Die Tofailys sind drob natürlich ganz außer sich vor Vergnügen.
Kodama wird von den Betrunkenen bestürmt — wie von arabischen Kriegern eine Burg bestürmt wird.
Die Vier sind im Nu umringt.
Und Alle wandeln lachend in die nächste Teebude. —
Schlitzäugige chinesische Mädchen bringen das heiße Getränk in blau bemalten Porzellanschalen herbei.
»Wie geht’s Deinem Bären?« fragt man den Safur — höhnisch — denn Safur wird beneidet. Sein Bär, Bagdads berühmte Köchin, leuchtet sehr hell an dem trüben Himmel, der Bagdads berühmte Männer überwölbt.
Abu Hischam muß gleich wieder vom Bunde der lauteren Brüder sprechen.
Doch es wird heiß.
Auch unter den hellen Leinendächern der Zelte und Marktbuden nimmt die Hitze ganz beträchtlich zu.
Die Augen kann man garnicht mehr ordentlich offen halten — die Sonne blendet.
Tiefblau sind die Schatten der Palmen und Bananen.
Vor den Teezelten liegt die große Moschee.
Und rechts von der Moschee ragen die hohen, auf einem Hügel gelegenen Paläste der Kalifenburg mit vielen vielen Türmen und bunten Galerien in den glühenden Himmel hinauf.
Träge zieht eine Karawane an den Teetrinkern vorüber.
Die Kamele nicken einförmig mit den drolligen Köpfen, die Pferde suchen mit der Schnauze den heißen Erdboden zu erreichen. Die Kameltreiber schwitzen und fluchen.
Träge zieht die Karawane vorüber — ein Bild tiefster Erschöpfung — ein Bild lähmender Schlaffheit.
Das Gespräch unter den Teezelten verstummt — man verabredet noch eine Zusammenkunft abends auf der Tigristerrasse — und trennt sich.
Abu Hischam, Kodama, Suleiman und Safur wenden sich nach rechts, gehen an einer großen Bude, die ganz mit kleinen indischen Götterfigürchen gefüllt ist, vorüber — in die Stadt.
In den Straßen ist es leer und heiß.
Die blauen Schatten der niedrigen zumeist fensterlosen Hausmauern und die blauen Schatten der Palmen und Bananen — verkleinern sich — die Sonne steht schon hoch.
Der dicke Kodama gähnt und will zur Sareppa, die Andern wollen mit, und man geht hin.
Der weiße Straßenstaub durchsengt die Sandalen.
Donnerwetter! Die Hitze ist stärker als tausend Löwen.
Die Vier nehmen erst noch ein Bad.
Das erfrischt ein bißchen.
Dann geht’s zur Sareppa.
Da knallen die Peitschen.
Da fliegen die Speere und die Pfeile.
Da wiehern und stampfen die prächtigsten Hengste — denn die Sareppa handelt mit Pferden, und ihre Hengste sind berühmt.
Auf einem freien Platze, der nur von ein paar Palmen beschattet wird, jagen junge nackte Mongolen auf schäumenden Hengsten im Kreise herum. Die Mongolen werfen dabei mit kurzen Lanzen nach einer Holzpuppe, die hoch oben unter den Blättern einer Palme hängt. Die Lanzen sausen oft in weitem Bogen fast bis auf die Straße hinaus, daß man sich in Acht nehmen muß.
Die beiden Gelehrten und die beiden Dichter gehen daher schleunigst unter ein Holzdach, unter dem Gras wächst — da grasen die Pferde der Sareppa, und — Beduinen bewundern die Pferde.
Manche Beduinen kaufen sich ein Pferd unter diesem Holzdache — doch die meisten Beduinen kommen hierher, um ihre Pferde zu verkaufen — und dann bettelnd herumzulungern.
Bagdad, diese üppige Stadt, bricht manchem Wüstensohn den Hals.
Und Safur spricht mit den Beduinen.
Er spricht von den blauäugigen Dschinnen und will mehr von diesen wilden Wüstengeistern wissen, die nachts auf schwarzen Rossen über den heißen Sand sprengen und die Menschen — töten wollen.
Die Beduinen erzählen viel von den Dschinnen. Und vor Safur, der träumend zuhört, erscheint ein wildes Weib mit schwarzem Gesicht und hellblauen Augen; die Haare hängen dem Weibe lang und strähnig an den Schläfen nieder. Die Stirn des schwarzen Weibes zeigt senkrechte dicke Furchen. Die Mundwinkel des bläulich— blassen Mundes hängen tief runter — ein dunkler Gespensterkopf vor einem leuchtenden Nachthimmel!
Safur erschrickt.
Und er liebt das Gesicht.
Aber plötzlich ist es wieder weg. Er sieht nur noch die Beduinen vor sich, sieht die Pferde der Sareppa grasen und den alten Suleiman drüben an dem einen Holzpfahl Kirschen essen.
Safur hört nicht mehr, was ihm die Beduinen erzählen. Er versucht wieder, das Dschinnengesicht zu sehen — kriegt es aber nicht fertig. Ganz verstört kommt er später zu seinen Freunden zurück und ißt schweigend mit ihnen Kirschen, trinkt auch Wein mit ihnen; der Kodama ist in bester Laune, hat an jeder Hand ein Mongolenmädchen und erzählt Schnurren, daß die Mädchen sich krümmen vor Lachen.
Die Sareppa badet, die ist heute nicht zu sehen.
Die Beduinen werden aber bald aufdringlich, die Obstjungens auch, sodaß man sich nach einiger Zeit entschließt, weiter zu wallen.
Kodama übernimmt die Führung und bringt seine Freunde in ein berüchtigtes Haus.
Man geht in den großen Badegarten, wo’s sehr laut ist. Beduinen und ein paar reiche Jünglinge aus Bagdads besten Familien zechen dort mit weißen Armenierinnen.
Das eine Mädchen singt mit gellender Stimme, während sie ihren Jüngling an die Ohren packt:
»Willst Du meine Freunde töten, Steigst Du noch in meiner Gunst! Blutig muß Dein Dolch erröten! Sonst ist Lieben eitel Dunst!«
Und das Unerwartete geschah.
Blitzschnell zog der Jüngling seinen Dolch und stieß ihn einem jungen Beduinen bis ans Heft in den Leib.
Aber im nächsten Augenblick hatte der Jüngling einen furchtbaren Säbelhieb. Der Säbel ging ihm durch die linke Stirnseite, durchschnitt das Auge und blieb im Kopfe stecken.
Lautlos brach der Heißblütige zusammen.
Das dunkelrote Blut zweier Nebenbuhler besudelte den feinen bunten Fliesenboden.
Entsetzt wandten sich die beiden Gelehrten und die beiden Dichter ab und schritten eilig an den Rosengebüschen und an den Gummibäumen — an dem reizenden großen Badeteich, in dem Lotosblumen blühten, vorbei — hinaus — ins Freie.
Drinnen schrien die Weiber wie die Wahnsinnigen, als wenn das berüchtigte Haus ein Tollhaus geworden wäre.
»Siehst Du!« sagte draußen der dicke Geograph zum Safur, »da siehst Du wieder, wohin die Leidenschaften führen. Hüte Dich vor der Eifersucht!«
Und im Sturmschritt rannte der Dicke seinen drei Freunden voran zur Tigristerrasse.
In Schweiß gebadet kamen die Vier dort an.
Die Tofailys waren schon da.
Die Sonne ging blutrot unter.
Hastig erzählten die Vier ihr Abenteuer.
Aber die Tofailys rührte das nicht allzu sehr. Sie waren ja des Morgens von einem Leichenschmaus gekommen — von dem Leichenschmaus, den die hübsche Witwe des alten Wollkremplers gegeben, den die Tofailys in jener grünen Schimmelnacht in der Betrunkenheit erstochen haben sollten.
Es ward Nacht.
Man aß und trank.
Abu Hischam sprach wieder vom Bunde der lauteren Brüder.
Und als Alle recht viel getrunken hatten, nahm Abu Hischam feierlich alle Anwesenden in seinen Bund auf.
Suleiman riet vergeblich zur Mäßigung. Er erinnerte vergeblich an die Empfindlichkeit des reichen Battany.
Abu Hischam nahm sämtliche anwesenden Tofailys sehr förmlich in den Bund der lauteren Brüder auf.
Und darauf trank man — bis Alles betrunken war. —
Die Tofailys lagen schließlich auf der Tigristerrasse umher wie die Scherben einer zerbrochenen Waschschüssel.
Safur dachte an seine Dschinne und an seine Tarub.
An seine Tarub dacht‘ er mit Ingrimm, denn er wußte, daß sie ihm wieder Vorwürfe seiner wüsten Sauferei wegen machen würde.
Der Tigris glitzerte im Mondenschein.
Die lauteren Brüder verstummten und begannen zu schnarchen; der Kopf ward ihnen so schwer wie ein Henkerbeil.
Safur dachte an seine blauäugige schwarze Dschinne.
Jetzt sah er sie wieder hoch oben im Himmel — übermenschlich groß — von funkelnden Sternen umstrahlt.